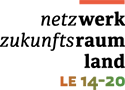Larvenzucht zur Futtermittelherstellung für Fische, Geflügel und Schweine
- Themenbereich
- Land- und Forstwirtschaft inkl. Wertschöpfungskette
- Innovation
- Klimaschutz und Klimawandel
- Umwelt, Biodiversität, Naturschutz
- EIP-AGRI
- Untergliederung
- Landwirtschaft
- Umweltschutz
- Naturschutz
- Energieeffizienz
- EIP Europäische Innovationspartnerschaft
- Innovation
- Wissenstransfer
- Klimaschutz
- Klimawandelanpassung
- Kurze Versorgungsketten
- Wertschöpfung
- Projektregion
- Oberösterreich
- Steiermark
- Wien
- LE-Periode
- LE 14–20
- Projektlaufzeit
- 1.5.2018-31.10.2021 (geplantes Projektende)
- Projektkosten gesamt
- 435.234,85€
- Fördersumme aus LE 14-20
- 435.234,85€
- Massnahme
- Zusammenarbeit
- Teilmassnahme
- 16.2 Förderung für Pilotprojekte und für die Entwicklung neuer Erzeugnisse, Verfahren, Prozesse und Technologien
- Vorhabensart
- 16.02.1. Unterstützung bei der Entwicklung neuer Erzeugnisse, Verfahren & Technologien der Land-, Ernährungs- & Forstwirtschaft
- Projektträger
- OG ARGE LARVENZUCHT
Kurzbeschreibung
Der europäische Eiweißfuttermittelimport verursacht momentan diverse Probleme: Zum einen ist die europäische Nutztierhaltung stark abhängig vom Weltmarkt, zum anderen trägt der Import von Soja und Fischmehl zu negativen ökologischen Folgen wie Treibhausgasen, Biodiversitätsverlust in den Ursprungsländern, und Überfischung der Meere bei. Durch den Einsatz von in Österreich gezüchteten und zu Futtermitteln verarbeiteten Insektenlarven lässt sich dies abmildern und können zugleich eine erhöhte Wertschöpfung im Inland erreicht und eine ressourceneffiziente Kreislaufwirtschaft gefördert werden.
Das Projekt wird durch die ARGE Larvenzucht realisiert: Mit Rest- und Nebenstoffen werden Larven herangezogen und zu Proteinfuttermitteln weiterverarbeitet. Das entstandene Futter wird analysiert und in Fütterungsversuchen getestet. Als eines der ersten Projekte dieser Art in Europa sollen die Ergebnisse verbreitet werden, um eine Trendwende zu initiieren.
Ausgangssituation
Derzeit werden in der europäischen Nutztierzucht primär Soja aus Südamerika und Fischmehl verfüttert, wodurch der Markt sehr abhängig von Weltmarktpreisen und dessen Preisschwankungen ist. Auch erhöht der Import die Treibhausgasemissionen und hat einen Biodiversitätsverlust aufgrund der Überfischung der Weltmeere und der Nutzung von Regenwäldern als Anbaufläche zur Folge.
Zur Lösung kann die Larvenzucht zur Verarbeitung in Proteinfuttermittel direkt in Österreich beitragen. Dies ist momentan im europäischen Raum wenig verbreitet, wird aber in den nächsten Jahren durch Gesetzesänderungen an Bedeutung gewinnen. Um hier globalen Playern zuvorzukommen und zu gewährleisten, dass lokal und in einer Kreislaufwirtschaft in Österreich Larven zur Verfütterung herangezüchtet werden, setzt das Projekt ARGE Larvenzucht schon jetzt an, eine landwirtschaftlich relevante Produktion von Futtermitteln aus Larven für konventionelle und biologische Aquakulturen, sowie die tierische Produktion von Monogastriern (Schweinen, Hühnern) zu entwickeln.
Ziele und Zielgruppen
Ziele:
- Verwendung regionaler Reststoffe aus der österreichischen Landwirtschaft oder landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette
- Messbarer Beitrag zur ökologisch nachhaltigen Entwicklung der Landwirtschaft
- Entwicklung einer geeigneten Prozesstechnik zur Herstellung von Futtermitteln aus Larvenprotein und Larvenöl
- Eignung des entwickelten Futtermittels für Fische und terrestrische Monogastrier
- Wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit des Endprodukts (Insektenlarven als Futtermittel)
- Erhöhung des Wissensstandes zur Proteinquelle Insektenlarven in den relevanten Zielgruppen
Zielgruppen:
Hauptzielgruppe sind landwirtschaftliche Betriebe (omnivore Monogastrier - Schweine, Hühnervögel) und Fischzuchten (räuberische Fische).
Zudem soll das erarbeitete Knowhow in der wissenschaftlichen Community und die Akzeptanz desselben in der allgemeinen Bevölkerung verbreitet werden.
Projektumsetzung und Maßnahmen
Die Operationelle Gruppe besteht aus:
- landwirtschaftliche Betriebe Michael Forster (Larvenzucht) und Fischzucht Hartl
- Ecofly GmbH
- Bio Forschung Austria (BFA)
- Global 2000 (G2 Umweltforschungsinstitut (UFI) und G2 Umweltschutzorganisation (USO))
- HBLFA Raumberg-Gumpenstein
- Bundesamt für Wasserwirtschaft
- Universität für Bodenkultur/Institut für Tierernährung, Tierische Lebensmittel und Ernährungsphysiologie
Um das Projekt umzusetzen wurden die folgenden Maßnahmen als Arbeitspakete definiert:
1. Evaluierung von verwendbaren Reststoffen und Nebenprodukten als Futter in der Larvenaufzucht und Weiterentwicklung der Produktionstechnik
2. Konservierung der Larven und Herstellung von Mischfuttermitteln unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Verarbeitung auf die Zusammensetzung und Verwertbarkeit
3. Fütterungsversuche mit Larvenprotein an Fischen und Hühnern, sowie an Schweinen und Hühnern mit Restsubstraten der Larvenzucht
4. Ökologische und ökonomische Analyse des Futtermittels auf Larvenprotein-Basis
5. Verbreitung der Ergebnisse in landwirtschaftlichen und wissenschaftlichen Fachkreisen
Ergebnisse und Wirkungen
Im Rahmen des Projekts wurden regional verfügbare und aufgrund ihrer hohen Umwandlungseffizienz für eine Aufzucht von Larven der Schwarzen Soldatenfliege praxistaugliche Futtersubstrate identifiziert. Das bei der Larvenzucht anfallende Restsubstrat eignet sich für eine Verwendung als organischer Dünger.Folgendes technisches Know-How für die Verarbeitung von Larven (teils der ganzen Larven, teils Larvenprotein, teils Larvenprotein plus Larvenöl) wurde erarbeitet:
- Haltbarmachung von Larven (zermahlen) über Silierung (Vorteil: energiearme Konservierung)
- Herstellung von Broiler-Mischfutter mit Larvenprotein und Larvenöl
- Herstellung von vielversprechendem Fischfutter
In Fütterungsversuchen mit Broilern wurde die Einsatzfähigkeit von Larvenprotein und -öl als Protein- bzw. Fettquelle untersucht. Es wurde gezeigt, dass die Fütterung von entöltem Larvenmehl bis zu 15% Sojaextraktionsschrot bei Masthähnchen ersetzen kann. Ein 100 %iger Ersatz von Sojaöl durch Larvenöl führte zu keiner Einschränkung in Bezug auf Tierleistung und Tierwohlbefinden. Larvenmehl und -öl der Schwarzen Soldatenfliege sind somit als Protein- bzw. Fettquelle in der Fütterung von Masthähnchen geeignet.
Für die Fischzucht geeignete Futtermischungen müssen neben Ansprüchen an die Zusammensetzung auch gewisse physikalische Eigenschaften wie z.B. eine bestimmte Sinkgeschwindigkeit in Wasser erfüllen. Im Projekt wurde eine für die Herstellung von auf Larven basiertem Fischfutter einsetzbare Verarbeitungsmethode mittels Extrusion entwickelt.
Berechnungen im Rahmen einer ökologischen Analyse haben gezeigt, dass es möglich ist, Larvenmehl in Österreich zu produzieren, das einen geringeren CO2-Fußabdruck aufweist als aus Südamerika importiertes Sojamehl. Das in der Larvenzucht eingesetzte Futtersubstrat ist dabei für den überwiegenden Teil der Klimawirksamkeit verantwortlich. Es wurde weiters gezeigt, dass durch Anpassungen von Produktionsparametern in den Bereichen Energiebedarf und Emissionen der CO2-Fußabdruck noch weiter reduziert werden kann.