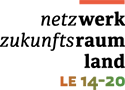ARGE Kreisläufe - Kreisläufe schließen
Verwertung durch Rückfuhr, Transfer oder Nutzung von organischen Nebenprodukten am landwirtschaftlichen Betrieb
- Themenbereich
- Land- und Forstwirtschaft inkl. Wertschöpfungskette
- Umwelt, Biodiversität, Naturschutz
- Klimaschutz und Klimawandel
- Innovation
- EIP-AGRI
- Untergliederung
- Landwirtschaft
- Innovation
- Klimaschutz
- Klimawandelanpassung
- Wasser
- Naturschutz
- Umweltschutz
- Wertschöpfung
- Boden
- EIP Europäische Innovationspartnerschaft
- Projektregion
- Burgenland
- Kärnten
- Niederösterreich
- Oberösterreich
- Steiermark
- Wien
- LE-Periode
- LE 14–20
- Projektlaufzeit
- 2019-2022 (geplantes Projektende)
- Projektkosten gesamt
- € 475.752,36
- Fördersumme aus LE 14-20
- € 475.752,36
- Massnahme
- Zusammenarbeit
- Teilmassnahme
- 16.2 Förderung für Pilotprojekte und für die Entwicklung neuer Erzeugnisse, Verfahren, Prozesse und Technologien
- Vorhabensart
- 16.02.1. Unterstützung bei der Entwicklung neuer Erzeugnisse, Verfahren & Technologien der Land-, Ernährungs- & Forstwirtschaft
- Projektträger
- ARGE Kreisläufe
Kurzbeschreibung
Im EIP-AGRI Projekt „Kreisläufe schließen“ wurden verschiedene innovative Maßnahmen, welche durch eine bessere Nutzung von Wertstoffen aus der Landwirtschaft Stoffkreisläufe am landwirtschaftlichen Betrieb und in der Region schließen und die Nährstoff- und Humuseffizienz verbessern können, in Praxisversuchen getestet. Untersucht wurden zwei verschiedene Cut-and carry-Variationen, einmal als Transfermulch, einmal in den Acker eingearbeitet; eine Kleegras-Mist- und Kleegras-Gülle-Kooperation und eine Kooperation, bei der Kleegras in einer Biogasanlage verwertet wurde. Auf drei Betrieben wurden verschiedene Kompostierungsverfahren getestet, darunter auf einem Betrieb auch ein extrem extensives Modell. Am Beispiel des Schulbetriebes der LFS Grottenhof in Graz wurde die Hoftorbilanz eines Gemischtbetriebes mit Ackerbau und Milchviehhaltung im Kompoststall untersucht und berechnet. Zusätzliche Versuche beleuchteten spezielle Aspekte, wie z.B. die Wirksamkeit einer Begrünung, um die Nährstoffe einer herbstlichen Gülledüngung aufzunehmen und über den Winter zu speichern, zur Gülleverdünnung und zur Mistlagerung mit und ohne Abdeckung. Alle in den verschiedenen Prozessen verwendeten Substrate wie Kleegras, Heu, Stroh, Hackschnitzel, Getreideausputz usw. wurden mengenmäßig erhoben, beprobt und auf ihre Inhaltsstoffe analysiert. Neben der Mengen-, Nährstoff- und Kohlenstoffbilanzierung wurde eine ökologische Bewertung in Form von CO2-Bilanzen sowie eine ökonomische Bewertung der Maßnahmen durchgeführt.Ausgangssituation
Durch die weitgehende Aufgabe der Nutztierhaltung in Ostösterreich und die aktuell zunehmende Spezialisierung der landwirtschaftlichen Betriebe weisen nur mehr wenige Betriebe einen einigermaßen geschlossenen Betriebskreislauf auf. Dies führt dazu, dass die meisten Betriebe auf externe Inputs angewiesen sind, durch deren steigende Preise die Kostenschere immer weiter aufgeht. Geschlossene Nähr- und Kohlenstoffkreisläufe könnten dem entgegenwirken, jedoch stellen diese die landwirtschaftlichen Betriebe vor neue Herausforderungen. Probleme ergeben sich beispielsweise in Bezug auf die Fairness von Kooperationen, die Nutzung von aktuell ungenutztem Luzerne- und Grünland-Aufwuchs, dem Konservieren und Einsatz von ungenutzten Reststoffen, von Verwendungsmöglichkeiten für die nicht als Futter nutzbarer Biomasse von Naturschutzflächen und die Nutzung von Gärresten, Digestat und Tonerden für eine möglichst hohe Humuswirkung. Diese Fragen beschäftigen viele landwirtschaftliche Betriebe brennend. Auch in den UN-Nachhaltigkeitszielen (2016), dem Circular Economy Package der EU (2015) und dem Österreichischen Regierungsprogramm (2017) wird die Relevanz von geschlossenen Kreisläufen hervorgehoben.Ziele und Zielgruppen
Hauptziel des österreichweit geplanten Projektes war das Schließen von betrieblichen Stoffkreisläufen und die Verbesserung der Nährstoff- und Humuseffizienz. Besonderes Augenmerk lag hierbei auf der Entwicklung und Testung von praktischen Maßnahmen mit den folgenden Schwerpunkten:- Stroh-Mist-Kooperationen zwischen Betrieben, zum Beispiel zwischen Ackerbaubetrieben und viehhaltenden Betrieben
- Biomasse-Transfer innerhalb eines Betriebes
- Kompostierung ungenutzter Reststoffe und anschließende Nutzung
- innovative Methoden bei der Nutzung von Gärresten, Komposten, Tonerden und von Biomasse von Naturschutzflächen
Zielgruppe des Projektes waren die landwirtschaftlichen Betriebe sowie landwirtschaftliche Beraterinnen und Berater und Schülerinnen und Schüler der landwirtschaftlichen Fachschulen, also die nächste Generation von praktizierenden Landwirtinnen und Landwirten.
Projektumsetzung und Maßnahmen
Auf zehn Standorten wurden innovative Maßnahmen mittels Nährstoffbilanzen und in insgesamt sieben Pilotversuchen bewertet. Um Stickstoff- und Kohlenstoffbilanzen zu erstellen, wurden die Abläufe aller Maßnahmen als „Prozesse“ in einem Systembild dargestellt und mit Nährstoffflüssen und gasförmigen Emissionen ergänzt. Alle in den verschiedenen Prozessen verwendeten Substrate wie Kleegras, Heu, Stroh, Hackschnitzel, Getreideausputz und Zuschlagstoffe wie Pflanzenkohle wurden beprobt und auf ihre Inhaltsstoffe analysiert, bevor sie auf den landwirtschaftlichen Betrieben kompostiert, konserviert, verfüttert, getauscht, oder transferiert wurden. Die so entstandenen oder erhaltenen organischen Dünger wie Kompost, Mist oder Gülle wurden ebenfalls auf ihre Inhaltstoffe untersucht. Die Mengen an Substraten und organischen Düngern wurden erhoben und so Nährstoffinput und -output gegenübergestellt. Nährstoffausträge wurden in einer Verlustquellenanalyse identifiziert. Die RMA führte eine ökologische Bewertung in Form von CO2-Bilanzen sowie eine ökonomische Bewertung durch und die beteiligten LandwirtInnen sorgten für die laufende Evaluierung hinsichtlich der Praxistauglichkeit. Die Ergebnisse wurden in einer praxisgerechten Broschüre zusammengefasst.Ergebnisse und Wirkungen
Im Projekt wurden standortangepasste Maßnahmen zum Schließen der innerbetrieblichen, zwischenbetrieblichen und regionalen Nährstoff- und Kohlenstoffkreisläufe landwirtschaftlicher Betriebe, die zur Verbesserung der Nährstoffnutzung beitragen entwickelt und getestet. Es wurden konkrete Daten zu den Nährstoffströmen erhoben, die bei Stroh-Mist-Kooperationen und den anderen innovativen Maßnahmen auftreten. Aus diesen Daten ließen sich wichtige Erkenntnisse für ähnliche Kooperationen ableiten. Verglichen mit dem Einsatz von synthetisch hergestelltem Stickstoffdünger, konnte mit allen Maßnahmen eine Nettoeinsparung von 200 – 600 kg Treibhausgasen (CO2e) je 100 kg ausgebrachten Stickstoff erzielt werden. Mit zunehmender Transportdistanz steigt der Anteil der durch die Transporte verursachten Emissionen an den Gesamtemissionen steil an. Bei einer Distanz von 0,5 km machen die Transport-CO2e-Emissionen im Mittel 3,4 % der Gesamtemissionen aus. Bei einer Distanz von 4 km sind es schon 22 % und bei 10 km verursachen die Transporte mit 41 % schon fast die Hälfte der Emissionen. Im Vergleich mit anderen biotauglichen, organischen Handelsdüngern mit Preisen von rund 7 € pro kg Stickstoff erzielten alle Beispiele mit Ausnahme der „Güllekooperation“ und der „Kleegraskompostierung mit Kohle“ eine Nettokosteneinsparung von ca. 130- 400 € pro 100 kg Stickstoff durch die Kreislaufbewirtschaftung. Langfristig wird es somit vielen Betrieben erleichtert werden, Kreisläufe zu schließen, Kosten einzusparen und die natürliche Bodenfruchtbarkeit zu erhalten und zu steigern.Erfahrung
Mit den getesteten Maßnahmen können österreichische Landwirtinnen und Landwirte die betriebseigenen Nährstoffkreisläufe verbessern. Vielen Praktikerinnen und Praktikern ist noch nicht bewusst, welche Nährstoffmengen sich in Reststoffen an und um den eigenen Betrieb verstecken, oder wie man diese konservieren oder transferieren kann. Durch die Inwertsetzung dieser Reststoffe ergibt sich hohes Einsparungspotenzial für externe Betriebsmittel, wie zum Beispiel externe Düngemittel mit deren Energieaufwänden bei Produktion und Transport. So vielfältig Österreichs landwirtschaftliche Betriebe sind, so herausfordernd ist auch die Bewertung der getesteten Maßnahmen im Sinne der Vergleichbarkeit mit dem Ziel, Handlungsempfehlungen für den einzelnen Betrieb abzuleiten. Fragen nach der für österreichische Betriebe durchschnittlichen Maschinenausstattung und den durchschnittlichen Schlagentfernungen zeigen die Notwendigkeit objektiver Bewertungskriterien oder flexibler Bewertungsmodelle.
Die Frage nach dem Einfluss der Flächenrotte auf die mikrobielle Veratmung von Kohlenstoff, verglichen mit der Festlegung in stabilen Humusaggregaten, ist nach wie vor Gegenstand der aktuellen Bodenforschung und bildet eine Unschärfe bei der Interpretation der Bewertung.
Die Erfassung des Gewichtes der untersuchten Materialien, wie etwa Kleegras, ist für Landwirtinnen und Landwirte mit einem erheblichen Zeit- und Maschinenaufwand verbunden. Die landwirtschaftlichen Projektpartnerinnen und -partner haben großen Einsatz erbracht, um diese Erfassungen durchzuführen.
Die Maßnahme der mikrobiellen Carbonisierung (mC) ist für Landwirtinnen und Landwirte mit Mietenkompostierung im Sinne von „Kreisläufe schließen“ schwieriger zu organisieren, da dem genauen „Rezept“ des mC-Komposts in der Praxis unterschiedliche Materialien (Reststoffe) vor Ort gegenüberstehen.
Die Nährstoffbilanz von Biogasgülle ist vielversprechend, im Detail aber herausfordernd, vor allem wenn die Anlage gemeinschaftlich betrieben wird. In der Praxis werden immer wieder Reststoffe angeliefert, deren Mengen- und Nährstoffgehalte nicht ermittelt werden können.
Kommunikation in Zeiten ohne persönlichen Kontakt ist herausfordernd. Dank der sehr gut funktionierenden Partnerschaft zwischen Landwirtschaft, Beratung und Forschung konnte das Projekt auch in Pandemiezeiten erfolgreich durchgeführt werden.
Weiterführende Informationen zum Projekt finden Sie auf der Website des Projektpartners Bio Forschung Austria sowie in einem Projektvideo.